Deutschland – Methan-Emissionen sind höher als bislang angenommen
22.04.2024 (ah) Methan (CH4) ist ein Hauptbestandteil von Erdgas und wird auch bei der Förderung von Öl und Kohle sowie in der Landwirtschaft (besonders durch intensive Tierhaltung) freigesetzt. Neben Kohlendioxid (CO₂) ist Methan ein Treibhausgas, welches die Klimaveränderung massiv mit versursacht.
Eine aktuelle Studie der Deutschen Umwelthilfe (DHU) und des britischen Ember Climate Institute, veröffentlicht am 10.04.2024, zeigt: Die Zahlen zu den klimaschädlichen Methan-Emissionen in Deutschland sind falsch. Der Braunkohletagebau könnte bis zu 184-mal mehr Methan-Emissionen verursachen als bisher bekannt. Der Gesamt-Methanausstoß in Deutschland fällt damit wohl 14 Prozent höher aus.
Umweltsatelliten, die europaweit die Luftverschmutzung überwachen, wurden ausgewertet. Die Daten zeigen eine besonders hohe Methan-Konzentration über den Tagebauen Hambach (Nordrhein-Westfalen) und Welzow-Süd sowie über dem Lausitzer Seenland (Brandenburg).
Die bisher offiziell angegebenen Methan-Berechnungen beim Braunkohleabbau basieren auf den Zahlen eines RWE-Tochterunternehmens – aus den 80er Jahren. Danach gibt Deutschland an, nur ein Prozent der Methan-Emissionen aus Braunkohle in der EU auszustoßen. Nach der neuen Studie ist die BRD für 44 Prozent der Produktion des fossilen Brennstoffs verantwortlich.
Die massive Unterschätzung der Emissionen ist ein Skandal. Methan ist ein gefährliches Treibhausgas. Der Erhitzungseffekt von Methan ist über 80-mal so stark wie der von Kohlendioxid, betrachtet über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die weltweiten Methan-Emissionen müssen schnell und stark sinken, um die 1,5-Grad-Grenze noch einzuhalten. mit dem Global Methane Pledge hat sich die Bundesregierung dazu verpflichtet, die eigenen Emissionen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Da Deutschland bislang einen wesentlichen Teil seiner Emissionen um einen möglicherweise dreistelligen Faktor zu niedrig angibt, ist dieses Versprechen wohl als wertlos zu bewerten. Bei der 26. Klimakonferenz im Jahr 2021 wurde die globale Verpflichtung zur Verringerung der Methanemissionen von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ins Leben gerufen, die Deutschland auch unterschrieben hat. Bisher haben sich 150 Länder angeschlossen und sich damit verpflichtet, die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber den Werten von 2020 zu reduzieren. Die Maßnahmen dazu sind frei wählbar.
Methan ist nicht nur der zweitgrößte Treibhausgasverursacher und heizt die Klimakrise an. Methan schadet zudem als Vorläuferstoff von bodennahem Ozon der Gesundheit und der Umwelt. Nach einer aktuellen Umfrage des Global Methane Hub wissen in Deutschland nur 30 Prozent der Befragten über den negativen Einfluss von Methan auf das globale Klima, die Luftqualität und die Gesundheit Bescheid. Die Bundesregierung kennt diese Einflüsse und hat dennoch bislang keine Methanminderungsstrategie vorgelegt. Die DUH fordern deshalb eine nationale sektorenübergreifende Methanminderungsstrategie und eine sofortige Messoffensive.
Studie „Methanausstoß“ veröffentlicht am 10.04.2024 Brief: Urgency to update Germany’s coal mine methane emission factor (Kurzzusammenfassung: Dringende Aktualisierung des Methanemissionsfaktor von Deutschlands Kohlebergwerken)
Pressemitteilung der DUH zur Studie „Methanausstoß“.
Mehr Tier- und Pflanzenarten gefährdet als bislang bekannt
22.02.2024 (ah) Es sind wohl eher zwei Millionen Arten, die vom Aussterben bedroht sind, und nicht eine Millionen. Zu diesem Ergebnis kommt die am Mittwoch den 8.11.2023 veröffentlichte Studie um den Biologen Axel Hochkirch, Kurator für Ökologie am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Luxemburg. Die Studie wurde in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. PLOS ONE ist eine internationale, multidisziplinäre Online-Fachzeitschrift der Public Library of Science (PLOS).
Die Wissenschaftler analysierten die Daten der bedrohten Arten aus den Roten Listen der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Das sind insgesamt 14.669 europäische Wirbeltier-, Wirbellose- und Pflanzenarten.
Die Ergebnisse: Vor allem sind die Insektenarten deutlich stärker gefährdet als bislang angenommen. Der Weltbiodiversitätsrat IPBES war für seinen Bericht 2019 noch davon ausgegangen, dass rund 10 Prozent aller Insektenarten in Europa gefährdet seien. Hochkirch und sein Team stellten fest: Es sind eher 24 Prozent gefährdete Arten. Der Grund dafür ist, dass inzwischen mehr Daten dazu vorliegen.
Besonders gefährdet sind Grashüpfer, Schnecken, Muscheln, Süßwasserorganismen und Moose. Diese Arten leben oft in nur kleinen, eng begrenzten Gebieten, z.B. in einem bestimmten Quellgebiet oder Bergregion. Werden diese „Spezial-Regionen“ als Lebensraum zerstört oder verändert ist eine Gefährdung der Art vorprogrammiert.
Unter den Süßwasserfischen sind 40 Prozent, unter den Süßwassermollusken (Süßwasserschnecken oder -muscheln) 59 Prozent der Arten gefährdet. Der Aal befindet sich inzwischen auf der höchsten Gefährdungsstufe, d.h. vom Aussterben bedroht.
Für Moose gab es bislang keine Rote Liste. Nach der Studie gelten 23 Prozent aller Moosarten als gefährdet. Moose finden sich vorwiegend in Mooren und in Berggebieten. „Sie sind als CO2-Speicher extrem wichtig und viel bedeutsamer als Bäume“, erklärt Hochkirch gegenüber der taz. „Keine Pflanzengruppe kann besser Kohlendioxid speichern als Torfmoose.“
Die Wissenschaftler haben europäischen Datensätze neu und genau ausgewertet. Die Ergebnisse lassen sich jedoch auf andere Regionen der Erde übertragen. Da die Datenlage in Europa sehr gut ist und sich hier die Situation schon dramatisch darstellt, ist wahrscheinlich die Biodiversitätskrise in anderen, weitaus artenreicheren Regionen, z.B. die Tropengebiete in Afrika und Asien noch deutlich brisanter. Diese sind bislang zudem nicht ausreichend erforscht.
- https://taz.de/Neue-Studie-zum-Artensterben/!5968590/
- Für die taz ist Journalismus nicht nur ein Produkt, sondern ein öffentliches Gut. Niemand muss für das Lesen von taz-Artikel bezahlen, aber guter Journalismus entsteht nicht aus dem Nichts. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus! JETZT UNTERSTÜTZEN
- Die Public Library of Science, zu Deutsch „Öffentliche Bibliothek der Wissenschaften“, ist ein nichtkommerzielles Open-Access-Projekt in den Vereinigten Staaten. Aufgebaut werden soll eine Bibliothek wissenschaftlicher Zeitschriften und andere wissenschaftlicher Literatur als frei verfügbare Texte.
Luftverschmutzung – macht krank, führt zu Kosten und wirtschaftlichen Verlusten
2.02.2024 (ah) Im März 2023 legte die Europäischen Umweltagentur (EUA) ihre Analyse zur Luftqualität in Europa 2022 vor. Die EUA schätzt die Sterblichkeit aufgrund von Luftverschmutzung seit 2014. Bis 2021 verwendete die EUA die Empfehlungen aus dem WHO-Bericht von 2013 für ihren Bericht. Bei der Bewertung für das Jahr 2022 wendet die EUA erstmals neue Empfehlungen zu gesundheitlichen Auswirkungen, die die WHO-Luftqualitätsrichtlinien von 2021 enthält. Die Änderung der Methodik führt zu einer geringeren geschätzten Zahl der Todesfälle als zuvor. Die EUA hat deshalb ihre früheren Schätzungen aktualisiert.
Die EUA ermittelt für das Jahr 2022, dass die Luftverschmutzung in Europa nach wie vor mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden ist, die zu chronischen Erkrankungen und vorzeitigen Todesfällen führen. 2020 waren in der EU 96 % der städtischen Bevölkerung Feinstaubkonzentrationen (PM2.5) ausgesetzt, die den WHO-Richtwert von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3) Luft überschritten.
Negativauswirkungen der Luftverschmutzung
Luftverschmutzung schadet nicht nur den Menschen, sondern auch der Artenvielfalt, den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und den Wäldern. Damit trägt sie zudem zu erheblichen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen sowie zu wirtschaftlichen Verlusten bei.
- Im Jahr 2020 verstarben in der EU 238 000 Menschen vorzeitig, weil sie PM2.5-Konzentrationen von über 5 µg/m3 ausgesetzt waren, schätzt die EUA. Die Stickstoffdioxid-Belastung führte zu 49 000 und erhöhte Ozonwerte zu 24 000 vorzeitigen Todesfällen.
- Land- und Wasserökosystemen werden durch die Luftverschmutzung geschädigt. 2020 waren 75 % der Fläche der Ökosysteme in der EU mit Stickstoff belastet das bedeutet einen Rückgang von 12 Prozent gegenüber 2005. Im Null-Schadstoff-Aktionsplan ist eine Reduzierung um 25 % bis 2030 vorgesehen.
- Im Jahr 2020 waren in Europa 59 % der Waldflächen und 6 % der landwirtschaftlichen Flächen schädlichen bodennahen Ozonkonzentrationen ausgesetzt.
- Die wirtschaftlichen Verluste aufgrund der Auswirkungen von bodennahem Ozon auf die Weizenerträge beliefen sich 2019 in 35 europäischen Ländern auf rund 1,4 Mrd. EUR. Die größten Verluste entstanden in Deutschland, Frankreich, Polen und der Türkei.
Website der Europäischen Union: Hier
Studie – Klimafunktion von Wäldern
8.05.2023 (ah) In Deutschland soll es ein Neues Waldgesetz geben. Naturschutzinitiativen fordern eine Verschärfung zum besseren Schutz der Wälder. demgegenüber steht die Waldwirtschaft die profitabel sein soll. Die Studienlage ist oft recht eindeutig und zeigt in welche Richtung ein Neues Waldgesetz gehen muss. sollen. Eine Gruppe Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit der Leuphana-Universität in Lüneburg und der Freien Universität Berlin veröffentlichte in der Fachzeitschrift Ecological Solutions and Evidence der British Ecological Society eine Studie zum Kühlungsvermögen von Wäldern (Jeanette S. Blumröder et al., 2019). Ausschlaggebend ist das Kronendach.
Wird das Kronendach um 10 % geöffnet, steigen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen um ungefähr ein halbes Grad Celsius. Während des heißesten Tages im Jahr 2019 betrug der Unterschied der Temperaturspitzen zwischen jenen mit relativ dichtem und solchen mit einem besonders offenen Kronendach mehr als 13°C.
Höhere Biomassevorräte (besonderes alte Bäume) und ein geschlossenes Kronendach, , seien demnach eine Versicherung gegen extreme Witterungen, folgerten die Wissenschaftler.
Sie empfehlen, das Kronendach so geschlossen wie möglich zu halten (mindestens 80%), indem ein hoher Bestockungsgrad sowie strukturreiche Mischbestände gefördert werden. Die allgemeine Abnahme der Wärme und die Vermeidung hoher Höchsttemperaturen trage auch effektiv zur Verringerung von Wasserdefiziten bei, da die Verdunstung nichtlinear mit steigenden Temperaturen zunehme. Die Minimierung der Temperatur des Waldinneren beeinflusst die Klimaregulierung in der weiteren Landschaft und die Wasser- und Kohlenstoffkreisläufe positiv. Mikroklimaregulierung könne daher negative Auswirkungen des Klimawandels abpuffern.
Eine effektive Waldbewirtschaftung mit dem Ziel einer kontinuierlichen Waldbedeckung und komplexerer Strukturen anstelle homogener Monokulturen ermögliche somit eine Stabilisierung der mikroklimatischen Bedingungen im Waldinneren und wirke extremen makroklimatischen Bedingungen entgegen, die unter dem Klimawandel zu erwarten seien.
Karl-Friedrich Weber langjähriger waldpolitischer Sprecher des BUND Niedersachsen betreibt die facebookseite Waldwahrheit. Hier befindet sich ein Fot von einem „heißgeschlagenen„ Eichen-Hainbuchenwald im FFH-Gebiet 101 – Wälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg – niedersächsische Landesforsten. Ein Beispiel dafür, wie schlecht Naturschutzflächen in Deutschland „geschützt“ sind.
https://www.facebook.com/Waldwahrheit/photos/a.140535152739981/5559459454180830/
Klimawandel gefährdet die Menschheit
2.03.2022 (ah) Der neue (sechste) Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) schildern eindrücklich die Diskrepanz zwischen dem Wissen über den Klimawandel und den tatsächlichen Maßnahmen. Das Ignorieren der Klimakrise gleiche einem „ständigen Überfahren von roten Ampeln.“ Überschwemmungen, Hitzewellen, Artensterben, Ernteeinbußen werden bei unzureichenden Gegenmaßnahmen die Erde unbewohnbar machen. Deutlicher kann es wohl kaum ausgedrückt werden.
Auch in Deutschland ist der Klimawandel nicht mehr zu übersehen. Das Absterben von Wäldern, landwirtschaftliche Verluste aufgrund der Dürre der vergangenen Sommer, die Überflutungen an Ahr und Erft im Juli 2021 mit den Toten der Ahr-Flut sowie die zunehmenden Hitzetoten, zeigen die Folgen unmissverständlich auf.
Der am 28.02.2022 veröffentlichte Bericht ist der zweite Teil des sechsten IPCC-Sachstandsberichts. Er umfasst 4.000 Seiten. Erarbeitet wurde er von 270 Wissenschaftlern, darunter 15 aus Deutschland. In fünf Jahren Arbeit haben die Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt über 34.000 klimawissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet.
Der dritte Teil befasst sich vor allem mit den Möglichkeiten, von fossilen Energieträgern loszukommen, das Klimagas Kohlendioxid aus der Atmosphäre abzuscheiden oder Finanzströme klimafreundlich umzuschichten. Die Veröffentlichung steht noch aus.
Bereits jetzt seien durch den Klimawandel weltweit 3,3 bis 3,6 Milliarden, der knapp acht Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, durch den Klimawandel hochgradig gefährdet.
Berechnungen zufolge werden u.a.:
- Im Jahr 2050 wird die Zahl der Menschen, die Küstengebieten leben (anfällig für Stürme und Überschwemmungen), auf mehr als eine Milliarde ansteigen.
- Bei einer Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius besteht für bis zu 14% der Arten an Land ein sehr hohes Risiko auszusterben.
- Bei einer Erderwärmung von zwei Grad Celsius würden von Schmelzwasser abhängige Regionen, 20% weniger Wasser für ihre Landwirtschaft nach 2050 haben.
- Bei einer Erderwärmung um 3 Grad Celsius besteht für 29% der Arten an Land ein sehr hohes Risiko auszusterben. Die Zahl der Hitzetoten in Europa dürfte sich bei einer Erwärmung um 3 Grad im Vergleich zu einem 1,5-Grad-Szenario etwa verdoppeln oder verdreifachen. Das würde die Gesundheitssysteme an ihre Grenzen bringen. Zudem gebe es dann starke Auswirkungen auf Ökosysteme im Meer und an Land.
- Selbst wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu dem vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden könnte, bleiben einige Folgen des Klimawandels unumkehrbar.
Der Weltklimarat mahnt:
- Anpassung sei möglich: u.a. besserer Hitzeschutz in Städten. Derzeit nehmen die Ökosysteme noch mehr Treibhausgase auf als sie selbst verursachten. Das ändere sich, wenn Urwald abgeholzt, Torfmoorgebiete trockengelegt werden oder der arktische Permafrost schmilzt. „Dieser und andere Trends können noch umgekehrt werden, wenn Ökosysteme instandgesetzt, wieder aufgebaut und gestärkt und nachhaltig bewirtschaftet werden“. Gesunde Ökosysteme und eine reiche Artenvielfalt sind die Grundlage für das Überleben der Menschheit.“
- Bei einem Stopp der Erderwärmung auf 1,5 Grad: Flutschutzanlagen an Küsten, bessere Bewässerungssystem in von Trockenheit bedrohten Gebieten errichten. Allerdings haben Schutzmaßnahmen auch ihre Grenzen (s.u. Daniela Schmidt).
- Zum Schutz vor dem Artensterben ist eine Ausweitung und bessere Vernetzung von Schutzgebieten geboten. 30 bis 50% der Landflächen, Süßwasserlebensräume und Meere müssten unter Schutz gestellt werden.
Stimmen zum ICCP-Bericht:
- Hans-Otto Pörtner, Ko-Vorsitzende des IPCC und Mitautorerklärte: „Die Möglichkeiten der Natur für unser Überleben zu sorgen, ändern sich mit dem Klimawandel enorm – Hunger nimmt zu, Wasser wird knapp“. Die genannten Folgen wird es auch in Mitteleuropa geben. Pörtner ist Professor für Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremen. Er hat eine Arbeitsgruppe des IPCC über die Folgen und Anpassungsmöglichkeiten mit geleitet.
- UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die internationale Gemeinschaft, die Klimakrise immer noch nicht ernst genug zu nehmen. „Dieser Verzicht auf Führung ist kriminell“, erklärte Guterres. Die weltgrößten Emittenten von Treibhausgasen machten sich „der Brandstiftung an unserem einzigen Zuhause schuldig“.
- Klimaforscherin Debra Roberts erklärte gegenüber dem Tagesspiegel: Die meisten bevorstehenden Herausforderungen könnten bewältigt werden, wenn die Welt nachhaltiger und gerechter gestaltet werden würde. „Dazu gehört Naturschutz, aber auch die Orte zu ändern, wo die meisten Menschen leben – also unsere Städte.“
- Daniela Schmidt, deutsche Biologin an der britischen Universität Bristol, erklärt im Tagespiegel, dass mit steigenden Temperaturen in der Landwirtschaft vielerorts „irgendwann das Wasser ausgehen“ werde . Dem IPCC-Bericht zufolge werden Anpassungsmaßnahmen wie künstliche Bewässerung in der Landwirtschaft künftig durch zunehmenden Wassermangel beschränkt sein.
- Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt den IPCC-Rat in seinem Tun und erklärt: „Der Bericht sei ein flammender Apell an die Bundesrepublik endlich sofort wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.“
Hauptaussagen zum Teil 1, Download: Umweltpakt Bayern
Der Weltklimarat: Zwei UN-Organisationen, Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) gründeten aufgrund der Erderwärmung 1988 das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), als zwischenstaatliche Institution, zu deutsch Weltklimarat. Inzwischen hat der IPCC 195 Mitgliedsländer und seinem Sitz in Genf. Das Gremium wertet wissenschaftliche Studien zum Klimawandel aus, für Entscheidungsträger in aller Welt und formuliert Empfehlungen für seine Mitgliedsstaaten. Der Weltklimarat legt seit seiner Gründung alle sechs bis sieben Jahre einen Sachstandsbericht vor und thematisiert dort Fragen zum Klimawandel: Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Natur und Menschen aus? Wie kann er gebremst werden? Welche Anpassungsstrategien gibt es? Der erste Sachstandsbericht wurde 1990 veröffentlicht. Weitere folgten: 1995, 2001, 2007, 2013/14. Der sechste Sachstandbericht wurde bereits teilweise veröffentlicht, der dritte Teil folgt im Herbst 2022 .
Pestizide reduzieren – schnell und dringend
27.0.1.2022 (ah) Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will nach der Veröffentlichung des Pestizid-Atlas 2022 den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft reduzieren. Finanzielle Anreize für Landwirte und eine Änderung des Ordnungsrecht seien dafür notwendig, erklärte die Bundesministerin.
Pestizid-Atlas
Die Initiatoren des Pestizid-Atlas sind die Heinrich-Böll-Stiftung, der BUND, das Pestizid Aktionsnetzwerk und die Monatszeitung Monde diplomatique. Die Verfassen schreiben: Jährlich erkranken weltweit 385 Millionen Menschen an Pestizidvergiftungen. 11.000 Menschen versterben, meist an Organversagen. Weltweit stieg der Einsatz von Pestiziden von 1990 bis 2017 um 80% an. Die jährlich ausgebrachte Menge an Pestiziden beträgt vier Millionen Tonnen weltweit und erwirtschaftet in 2019 einen Umsatz von knapp 85 Milliarden Dollar. Vier große Konzerne kontrollieren mittlerweile 70% des Pestizidmarkes: Syngenta, Bayer, Corteva und BASF.
In Deutschland werden jährlich zwischen 27.000 und 35.000 Tonne Pestizide verkauft. Schädlingsbekämpfungsmittel belasten Menschen, Natur und Umwelt. Sie schädigen nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge, wie Bienen und andere Insekten. Spuren von Pestiziden lassen sich nachweisen, u.a. im Bier, Honig, Obst, Gemüse, im Gras, auf Spielplätzen, im Urin und der Luft. An Luftmessstellen ließen sich Pestizide nachweisen, die bis zu 1.000 Kilometer weit entfernt aufgebracht wurden. Das macht deutlich warum sie auch in Naturschutzgebieten zu finden sind. Pestizidfreie Zonen sind rar.
Pestizid-Äpfel
Über eine Millionen Tonnen Äpfel werden jährlich in Deutschland geerntet. Das reicht um etwa 70% der inländischen Nachfrage zu decken. Der Apfelanbau erfolgt jedoch mit dem häufigsten Pestizideinsatz. Bis zu 28 Mal werden die Bäume im konventionellen Anbau durchschnittlich behandelt. Weinreben werden im Vergleich 17 und Hopfen 14 Mal mit Pestiziden benetzt.
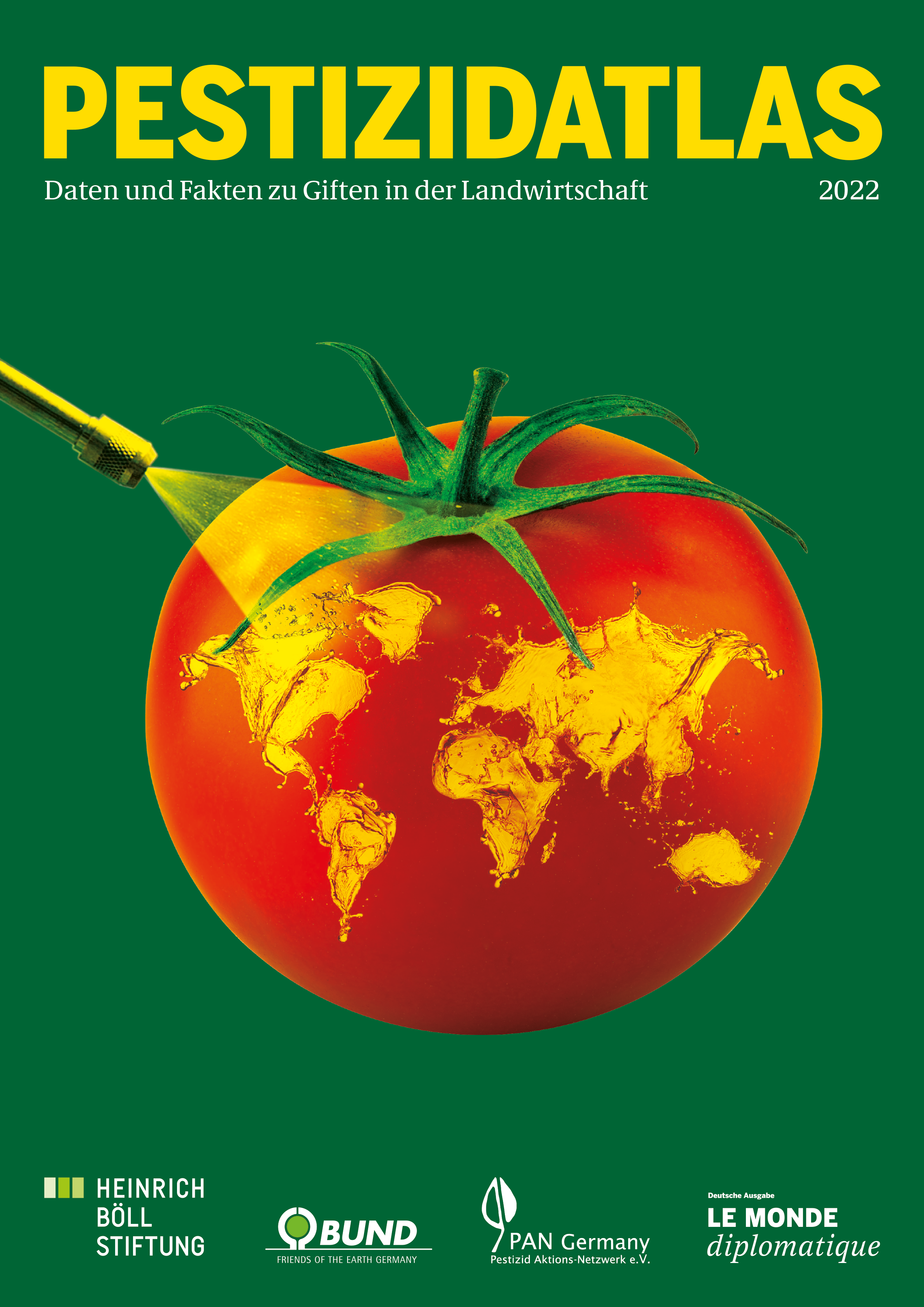
Der Wald in Deutschland auf dem Weg in die Heißzeit
Die Hochschule Eberswalde hat für Greenpeace Satellitendaten aus den Jahren 2018 bis 2020 ausgewertet. Sie zeigen, dass intensiv bewirtschaftete Forste deutlich stärker unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden als naturnahe Wälder.
Großbritannien – Grünflächen unterstützen Gesundheit
2.11.2020 In einer Studie der Universitäten Plymouth und Exeter und der Univ. Wien wurden mehr als 8.000 Erwachsene in Großbritannien zum Rauchverhalten im Zusammenhang mit grünem Lebensraum befragt. Ergebnis: Wer im Grünen lebt hat deutlich besser Chancen, nie Raucher zu werden, bzw. mit dem Rauchen aufzuhören. Sabine Pahl, Co-Autorin und Spezialistin für Stadt- und Umweltpsychologie an der Universität Wien, erklärte: „Ein höherer Grünflächenanteil ist mit einer Verringerung ungesunder Verhaltensweisen verbunden. Dies wurde mit der Studie erstmals belegt.“ Damit stützt auch diese Studie, wie bereits auch andere Studien zeigten, dass Naturräume dem Stressabbau dienen und das Wohlbefinden steigern. Fachartikel veröffentlicht in Social Science & Medicine, Elsevier.
Schwäbische Alb – Insektensterben schlimmer als gedacht
1.11.2020 50-jährige Untersuchungen an migrierenden Schwebfliegen, Waffenfliegen und Schlupfwespen belegen extreme Rückgänge. Untersuchungen von Dr. Wulf Gatter am Randecker Maar in der Schwäbischen Alb zeigen einen deutlich dramatischeren Rückgang von Insekten, als der nachgewiesene Insektenrückgang der Krefelder Studie, der über einen Zeitraum von 27 Jahren erfolgte.
Seit 1970 zählten die Forscher in der Schwäbischen Alb viermal stündlich je eine Minute die nach Süden durchfliegenden Schwebfliegen und rechneten das Ergebnis auf die Stunde hoch. Verglichen wurden fünf Jahre, von 1970 bis 1975 mit den Werten der Jahre 2014 bis 2019. „Der Vergleich der ersten fünf Jahre zeigt bei der größten und artenreichsten Gruppe, deren Larven räuberisch vor allem von Blattläusen leben, einen Rückgang um 97 Prozent gegenüber den Ausgangswerten.“
Die Untersuchung mit Insektenreusen erfolgt stündlich bei geeignetem Wetter. Der Vergleich der Erhebungen von 1978 bis 1987 mit denen von 2014 bis 2019 zeigt einen Rückgang von rund 90 Prozent jener Schwebfliegen-Arten, deren Larven sich von Blattläusen sowie weiteren Kleininsekten und Milben ernähren. Zwei andere Artengruppen, Waffenfliegen und parasitische Schlupfwespen, gingen im Zeitraum von 35 bis 40 Jahren um 84 beziehungsweise 86 Prozent zurück. Fachartikel in Entmologische Zeitschrift, Bd. 130, Sep. 2020, Wissenschaftlicher Verlag PKES
Studie Ökolandbau – von Greenpeace beauftragt
24.10.2020 Deutschland muss für Ökolandbau mehr Geld locker machen. Deutschland hinkt hinter anderen EU-Ländern hinterher. Österreich bewirtschaftet rund 24% der Agrarflächen nach Bio-Standards, Estland und Schweden 20%, in Deutschland sind es 8,5%. Damit liegt Deutschland im hinteren Mittelfeld der EU-Länder. Schuld daran ist die mangelnde Förderung durch die Bundesregierung: 2018 wurde der Ökolandbau mit 344 Millionen Euro gefördert. Notwendig wären eine Milliarde Euro jährlich, um das EU-Ziel erreichen zu wollen, den Ökolandbau auf 25% der Ackerflächen bis 2030 zu steigern. Dies besagt eine am 19.10.2020 veröffentlichte Studie, im Auftrag von Greenpeace beim Kassler Institut für ländliche Entwicklung.
Vogelstimmen einfangen – DAWN CHORUS Studien
6.05.2020 DAWN CHORUS Studien – vom 1. bis 31. Mai 2020 konnte jeder Bürger an einem weltweiten Vogel-Chor für die Wissenschaft und die Künste mitarbeiten, ganz bequem von zu Hause.
DAWN CHORUS ist ein Projekt von BIOTOPIA (Naturkundemuseum Bayern) und der Stiftung Nantesbuch, inspiriert von der Arbeit des „Vaters des Soundscaping“ Bernie Krause.
Mit dem Handy wurden Vogelstimmen aufgenommen und auf einer Soundmap hochgeladen. Die lokalen Aufnahmen wurden weltweit kartiert. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einer wachsenden, wissenschaftlichen Datensammlung für die Biodiversitätsforschung, die ab jetzt alljährlich stattfindet. Einflüsse von Lärmverschmutzung werden ebenfalls untersucht. Zugleich konnten Texte, Gedichte, Gedanken oder Bilder, etc. eingereicht werden, um so Teil eines weltumspannenden künstlerischen Projekts zu werden.
3.500 Menschen weltweit, aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Türkei, USA, Japan, Südafrika, Australien, Sri Lanka, Bhutan, Indien, Nicaragua, Mauritius und andere haben den morgendlichen Vogelgesang auf DAWN CHORUS hochgeladen und mit Menschen in aller Welt geteilt. Über 65.000 Follower in den sozialen Medien zeigen ihre Begeisterung.
Mehr unter: https://dawn-chorus.org/news-de/

SZ 6.05.2020, Seite 13
Deutschland – Zahl der Vögel rückläufig
5.02.2020 Die Zahl der Vögel geht auch in Deutschland zurück, ermittelt durch das Bundesamt für Naturschutz und dem Dachverband Deutscher Avifaunisten.

Bayern – Zahl der Schmetterlinge rückläufig
27.01.2020 Insektensterben in Bayern. Die Schmetterlingsbestände sind rückläufig, wie eine neue Studie „Langfristige Bestandsentwicklung von Schmetterlingen in Bayern“ in der aktuellen Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Anliegen Natur“ zeigt. Die Forscher verglichen sog. Altnachweise aus den Jahren 1980 bis 2008 mit neuen Kontrollen der Fundstellen in den Jahren 2010 bis 2017: 65% der Altnachweise konnten nicht mehr bestätig werden.

Aufwachen – 75% der fliegenden Insekten sind verschwunden
2017 (ah) Forscher bestätigen, was bislang ein ungutes Gefühl war: Die Anzahl heimischer Falter, Käfer, Bienen und vieler anderer Insekten in Deutschland ist seit 1989 um etwa drei Viertel geschrumpft. Auch für Pflanzen und Vögel könnte das Folgen haben.
Diese erschreckenden Ergebnisse der sog. Krefelder-Studie sind in allen Medien der Presse zu finden. Wissenschaftler aus Krefeld und internationale Forscherkollegen, untersuchten über 27 Jahre hinweg den Zustand und die Entwicklung der lokalen Insektenfauna in Naturschutzgebieten in Deutschland. Der in Naturschutzgebieten festgestellte Insektenverlust, ist besonders beunruhigend. Im Umkehrschuss bedeutet das: Geschützte Gebiete sind nicht ausreichend geschützt. Die Folgen könnten dramatisch sein, z.B. Tierarten, die Insekten zur Ernährung brauchen werden aussterben, da ihnen die Nahrung fehlt. Nahrungsmittel werden sich verknappen, da Insekten zum Bestäuben der Blüten fehlen. Menschen werden auf einige Lebensmittel verzichten müssen, z.B. Obst, Gemüse, Kräuter. Aufgrund des Fehlens von gesunden, frischen Nahrungsmitteln können Krankheiten für den Menschen entstehen.
Ist es nicht endlich Zeit aufzuwachen und umzudenken? Naturflächen und Naturschutzgebiete müssen viel mehr als bisher geschützt und gehegt werden und insgesamt müssen sie mehr werden.
SZ, Dramatischer Insektenschwund in Deutschland, 18.10.2017: http://sz.de/1.3713567
18.10.2017, Veröffentlichung der Studie in der Fachzeitschrift „Plos One“: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
